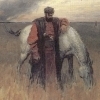Russischer Frühling
Alchevsk, 8. Dezember 2014
Boris friert entsetzlich, als er das warme Auto verlässt, um die letzten Schritte zum Hauptquartier der Brigade Prizrak zurückzulegen. Seit Wochen plagt der Journalist einer systemkritischen Zeitschrift sich mit einer verschleppten Erkältung herum, die er mittlerweile mit einer Mischung aus Tee und Cognac zu bekämpfen versucht.
Als er das wuchtige Gebäude, Kern eines stillgelegten Betriebsgeländes, erreicht, kommen zeitgleich zwei LKW mit Kennzeichen aus der Region Rostov am Don an. Eine Reihe Uniformierter beginnt sofort mit der Entladung. Boris sieht Säcke mit Mehl und Kartoffeln, Kartons mit Konserven, dicke Winterkleidung. Eine Frau mittleren Alters, stämmig aber nicht unattraktiv, koordiniert die Entladung. Nebenbei unterhält sie sich mit einer anderen Frau. Sie ist älter und hält die Hand ihres Enkels. Nach einem kurzen Wortwechsel läuft die Verwalterin ins Innere des Gebäudes und kommt mit zwei prall gefüllten Plastiktüten zurück. Wieder sprechen die beiden Frauen miteinander, die Milizionärin beginnt plötzlich zu weinen, begibt sich erneut in das Gebäude und bringt eine weitere Tüte mit. Die Frauen umarmen sich zum Abschied.
»Bekommen Sie denn keinen Ärger?«, will Boris besorgt wissen, doch die kräftige Verwalterin schüttelt verlegen lächelnd den Kopf. Der Brigadekommandeur kümmert sich um die Zivilbevölkerung, erklärt sie beinahe freudig. Die Brigade, so erzählt sie nicht ohne Stolz dem Journalisten, unterstützt vier Suppenküchen sowie mehrere Schulen und Heime.
Boris nickt verstehend und lässt sich den Weg zum Büro des Kommandeurs erklären. Aleksei Mozgovoy ist unterwegs. Ein junger Adjutant führt den Journalisten in das Büro des ebenfalls abwesenden Stabschefs und bietet ihm einen stark gezuckerten Tee an. Boris lehnt dankend ab und hält dem schmächtigen Burschen seine flache Flasche mit seinem ›persönlichen Erkältungsmedikament‹ hin.
Der Offizier hebt abwehrend die Hände. Im Hauptquartier herrscht striktes Alkoholverbot. Die ›Ukrops‹ (russ. für Dill, Spottname für die ukrainischen Truppen) haben Probleme mit Alkohol und Drogen, meint der Adjutant geringschätzig. »Der Kommandeur möchte, dass wir einen klaren Kopf behalten. Nur so können wir siegen.«
Im Zimmer des Stabschefs sieht Boris ein Foto des bayerischen Schlosses Neuschwanstein mit verschneiten Dächern. ›Hauptquartier Winter 2015‹ hat jemand mit einem dicken Faserschreiber darauf vermerkt. Ob er das Gebäude kenne, will Boris von dem jungen Offizier wissen. Dieser schüttelt den Kopf. Das Foto hat dem Stabschef gefallen, antwortet er. »Es hat keinen tieferen Sinn. Wir kämpfen für Novorossia, nicht um die Weltherrschaft.« Er lacht knabenhaft. Im Korridor hallen feste Schritte.
»Der KomBrig (russ. Kürzel für Brigadekommandeur) ist da«, behauptet der Adjutant und führt den Journalisten zur Zimmertür. »Er wird Sie sofort empfangen.« Boris nickt erleichtert. Er hat heute noch einen weiteren Termin wahrzunehmen.
Aleksei Mozgovoy ist kräftig und mittelgroß. Er trägt eine Uniform mit dickem Pelzkragen, dazu eine auffällige Pelzmütze mit der Kokarde der Donkosaken. Bewaffnet ist er nur mit einer altertümlichen Pistole des Typs Mauser C96. Sein Blick ist streng und beherrscht, Boris verspürt in der Gegenwart des charismatischen Milizkommandeurs ein leichtes Unbehagen. Er wird in das Arbeitszimmer gebeten.
Das Büro des Kommandeurs wirkt aufgeräumt. Der Schreibtisch ist voller Unterlagen und anderer Gegenstände, aber ordentlich strukturiert. Neben einem zugeklappten Notebook liegen in Reih und Glied mehrere Mobiltelefone bereit. Daneben Kleingebäck und ein halbvoller Aschenbecher. An den Wänden hängen zwei Flaggen: die Kriegsfahne Neurusslands und eine weitere, die auf den ersten Blick wie eine Piratenflagge aussieht. »Ein Geschenk der russisch-orthodoxen Armee«, sagt Mozgovoy sachlich. Boris liest die Inschrift um den Totenschädel: ER wird kommen und richten über die Lebenden und die Toten. Amen.
Sie nehmen platz, der junge Offizier, der sich bisher um den Journalisten gekümmert hat, bringt heißen Tee. »Sie haben eine Viertelstunde«, sagt Mozgovoy nach einem Blick auf die Uhr und nimmt die Pelzmütze ab. Sein Kopf ist kahlrasiert, der Bart zeigt erste Silberfäden. Der Kommandeur ist noch keine vierzig.
Mozgovoys Stimme hat einen melodischen Klang. Er hat vor dem Krieg als Solist in einem Chor gesungen, weiß Boris. Ruhig beantwortet er die Fragen des Journalisten. Auch die unbequemen. Aus seinen Überzeugungen macht er keinen Hehl. Der Blick des Kommandeurs bleibt während der ganzen Zeit streng und sachlich. Doch wenn er von seinen Visionen von Neurussland spricht, strahlen seine Augen. »Ich bin für eine Volksdemokratie«, erläutert der Milizenführer. »Unsere Feinde sind nicht die Ukrainer, sondern die Faschisten und die Feudalherren, die sich das gesamte Land untertan gemacht haben und nach Belieben ausbeuten.«
Erst zum Abschied lächelt Mozgovoy für einen Moment. Übergangslos wirkt er auf Boris nun freundlich und sympathisch. Unter anderen Umständen wäre der Brigadekommandeur gewiss ein umgänglicher Mann, vermutet der Journalist beim Verlassen des Gebäudes mit einigem Bedauern. Gerne würde er ihn nach dem Krieg erneut interviewen.
Auf dem Weg zu seinem Auto begegnen Boris zwei junge Frauen. Mitten im Krieg sind sie modisch gekleidet in dicke Winterjacken und bunte Schals, blickdichte Strumpfhosen und hohe Stiefel. An der Jacke der einen flattert ein Stoffbändchen in den Farben des Georgskreuzes: schwarz und orange - symbolisch für Pulverrauch und Feuer. Boris spricht sie an und erfährt, dass die beiden jungen Damen Lehrerinnen an einer Schule gleich um die Ecke sind. Das Notstromaggregat ist defekt und die Miliz soll helfen. Wir bekommen bestimmt ein neues Gerät, meint die eine. Aleksei Borisovich lässt uns nicht ohne Strom, ist die andere sich sicher und fügt hinzu: »Das ist immer so«.
Sie trennen sich. Die Lehrerinnen setzen ihren Weg zum Hauptquartier fort, der Journalist steigt in sein abgekühltes Auto. Ein Stückweit sind seine Ansichten erschüttert. Der seinerseits erwartete ›Warlord‹ hat sich ihm als nachdenklicher und charismatischer Visionär präsentiert, dem die Menschen am Herzen liegen. »Meine Nationalität ist Mensch«, hat während des Interviews der in der Region Lugansk geborene Kommandeur beiläufig angemerkt.
Auf der langen Fahrt zum nächsten Termin breiten sich in Boris einige Zweifel aus. Zaghaft, aber sie sind nicht einfach wegzuschieben. Er muss an die Milizionärin denken, die weinend einer älteren Frau und ihrem Enkelkind geholfen hat, an die beiden Lehrerinnen, für die es hinsichtlich der Unterstützung durch die Miliz keinerlei Zweifel gab.
Was immer Boris in seiner Zeitschrift berichten wird, kann diesmal nur ein selbst erlebter Moment einer Wirklichkeit sein, die im Strudel der Propaganda und gegenseitigen Schuldzuweisungen ein Schattendasein fristet. Angesichts der Überzeugtheit der Menschen, denen er heute begegnet ist, fühlt er sich mit seinen Zweifeln plötzlich sehr klein. Aber insgeheim weiß er, dass um ihn herum gerade Großes geschieht, und als er an einer roten Ampel anhalten muss, beschließt er spontan, seine eigene Rolle im Geschehen zu überdenken. Denn hin und her gerissen zwischen den westlichen Werten und der slawischen Kultur schlummert auch tief in seinem Innern die russische Seele.
Taras Sirko - 10. Dez, 13:01
Sie verfügen über den Abschluss einer Militärhochschule, beherrschen nicht weniger als drei Sprachen, haben mindestens den Rang eines Hauptmanns und können mit jeder vorgefundenen Waffe umgehen. Sie unterstehen dem russischen Militärnachrichtendienst GRU (Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, Hauptverwaltung für Aufklärung) und nennen sich Speznas. Ihre Aufgaben: Fernaufklärung, asymmetrische Kriegführung und Terrorismusbekämpfung. Die Ausbildung der Speznas gehört weltweit zu den härtesten, in der Abschlussprüfung muss man zwölf Angreifer abwehren können, um in den Verband aufgenommen zu werden.
Einer dieser Elitekämpfer war der heutige Oberst der Reserve Igor Girkin, besser bekannt unter dem Namen Igor Strelkov. Der Name Strelkov ist vom russischen Wort Strelok (Schütze) abgeleitet. Der frühere GRU-Offizier beherrscht seine Aufgaben. Der Ostukraine-Konflikt ist sein fünfter Krieg. Zweimal nahm er an militärischen Aktionen in Tschetschenien teil, je einmal war er in Transnistrien und in Bosnien eingesetzt. Der 43-jährige Strelkov ist Militärberater. Als solcher versteht er sich auf die Bildung und Ausbildung militärischer und paramilitärischer Verbände. Er berät Politiker und Kommandeure oder nimmt selbst an Kampfhandlungen aktiv teil. Die US-Äquivalente sind die Green Berets und die Navy SEALs, also Einheiten, die oftmals im Geheimen und wenig konform mit der zivilen Rechtsordnung oder zumindest in einer Grauzone operieren.
Die Berichterstattung der westlichen Medien über Strelkov lässt kein gutes Haar an ihm. Folgt man allerdings den zahllosen Links über angebliche Informationen hinsichtlich des »Kriegsverbrechers Girkin«, so gerät man schnell in eine aus Mutmaßungen und unbelegten Behauptungen bestehende Endlosschleife, ohne dass man dabei konkreten Fakten begegnet. Jeder Berichterstatter verweist auf die Angaben eines anderen Berichterstatters. Nichts Genaues weiß man nicht, aber Hinz hat gesagt, dass Kunz irgendetwas ganz genau weiß. Der einstige Militärchef der pro-russischen Separatisten, seine umstrittene und in den jeweiligen Lagern höchst unterschiedlich bewertete Persönlichkeit bleibt also verborgen im Nebel. Da kann es nicht weiter verwundern, wenn Strelkov wahlweise als »Putins Mann für das Grobe« oder als »oppositioneller Weißgardist« dargestellt wird. Eines ist er indes immer: der Hauptübeltäter.
Dabei macht Strelkov selbst keinen Hehl bezüglich seiner Vergangenheit und seinen Aktionen auf der Krim und im Donbass. Umfassend spricht er über seine Teilnahme an der Blockierung ukrainischer Kasernen auf der Krim, über die Rolle als Milizkommandeur in Slavjansk und Umgebung, über die kurze Zeitspanne als Verteidigungsminister der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk und über die Gründe seines Weggangs. Auch über den Umgang mit Plünderern, Vergewaltigern und Fahnenflüchtigen redet er freimütig. Aus seiner Sicht gehört es zur militärischen Tradition, dass Gesetzesbrecher in Kriegszeiten erschossen werden. Das europäische Verständnis des formellen Rechts findet bei ihm keinen Anklang. Strelkov denkt und handelt gemäß militärischer Erwägungen.
Über seine Beteiligung auf der Krim ist nur bekannt, dass er dort als militärischer Berater der pro-russischen Separatistenführer fungierte. Spätestens nach dem Referendum und der Aufnahme der Krim in die russische Föderation begab er sich in den Donbass, wo er an den Gefechten aktiv teilnahm und das Kommando über die Brigade Sewer (Norden) ausübte. Das Einsatzgebiet des Verbands war die Region um die Städte Slawjansk und Kramatorsk - beides pro-russische Hochburgen. Um meine Leserschaft nicht mit Endlosbeschreibungen überzustrapazieren, wird über die Belagerung von Slawjansk später gesondert berichtet.
Igor Strelkov sieht Russland, die Russen und die pro-russischen Ukrainer in einer Neuauflage des Großen Vaterländischen Krieges, wie in Russland der Krieg zwischen Hitlerdeutschland und Sowjetrussland bezeichnet wird. Damit ist er nicht allein. Von Anfang an gelten die neue Kiewer Regierung und der Euromaidan in den Augen vieler Menschen im Osten und Südosten der Ukraine als faschistische Elemente, als Nazis, denen gegenüber es keine Rücksichtnahme geben darf. »Aus zwanzig Millionen Gräbern«, so ein Separatistenführer kürzlich, »ruft man uns zum Kampf gegen den Faschismus auf.« Dieser Kampf, ganz gleich ob seine Beweggründe zutreffen oder nicht, vereint konservative Reformer, Kommunisten, Zaristen und andere Strömungen miteinander und lässt vorherige Befindlichkeiten der einzelnen Gruppen in den Hintergrund treten.
Auch aus Strelkovs Sicht ist der Kampf gegen die Nazis wiederentflammt. Während man in den USA und in der EU überhaupt keine Faschisten in der Ukraine sehen will, sehen viele pro-russische Kräfte in der Mehrheit der pro-westlichen Ukrainer in der Tradition des Ultranationalisten Stepan Bandera - und Hitlers. Doch er übt insbesondere auch Kritik am Kreml und am russischen Präsidenten. Er wünscht sich eine größere Unterstützung des russischen Staates und weniger Verzagtheit der Staatsführung. Seine diesbezüglichen Aussagen fallen bisweilen sehr hart aus. Die gängige Einschätzung, Strelkov wäre lediglich Putins Handlanger, erscheint hierdurch in einem anderen Licht. Vermutlich hat die Situation sich längst verselbständigt.
Wie bereits erwähnt: Jeder weiß angeblich etwas über Strelkov zu berichten, doch die Belege fehlen in aller Regel. Manche Aussagen bestätigt der Oberst sogar unverhohlen. Fehlende Beweise mögen zwar nicht über Wahrheit und Unwahrheit entscheiden, aber gar nichts zu wissen und vieles zu vermuten, ist unseriös. Ein Beispiel: Strelkov wird nachgesagt, er hätte sich darüber beklagt, dass keine 1.000 Männer im Donbass bereit wären, für ihre Heimat zu sterben. Anhand der Fakten eine sehr verwunderliche Aussage, denn Strelkov verfügte zu diesem Zeitpunkt über etwa 5.000 Freiwillige - aber über weniger als 2.000 Waffen! Die Details werden demnächst im Beitrag über die Kämpfe um Slawjansk aufbereitet.
»Strelkov. Russisch. Hart.« - Dieses Statement stammt nicht von mir, auch wenn ich es als Titel meines Beitrags verwende. Es handelt sich vielmehr um die Schlagzeile einer russischen Politikzeitschrift, die unter dieser Überschrift ein umfangreiches Interview mit Igor Strelkov veröffentlichte. Hierin schildert der bekennende russisch-orthodoxe Christ seine Sicht der bisherigen Geschehnisse in der Ostukraine. Immerhin ist es eine Geschichte aus erster Hand.
Igor Strelkov, soviel steht fest, ist an unseren westlichen Maßstäben nicht messbar. Nur ganz wenige Menschen werden sich in seine Position hineinversetzen können. Gemäß seiner Selbstbeschreibung sieht der Oberst sich in der militärischen Tradition des in Russland sehr bekannten Atamans Platov. Als Kavallerieoffizier und als Kämpfer für kollektive Freiheit, die sich deutlich von der individuellen Freiheit unterscheidet. Gemeinsam mit anderen Milizkommandeuren, besonders dem Lugansker Brigadekommandeur Aleksei Mozgovoy (dem bei Gelegenheit ein eigenes Porträt gewidmet wird), verfolgt er die Vision eines unabhängigen Staates in den Grenzen des historischen Neurusslands, in dem eine Volksdemokratie herrschen soll.
Zumindest ist Igor Strelkov nach seinem Weggang aus dem Donbass gegenüber den Menschen dort loyal geblieben. Viele Einwohner der Ostukraine schätzen Strelkov wegen seiner Ideale, seiner militärischen Ehre und seiner Integrität. Ein anderer Milizkommandeur nannte ihn unlängst »das Banner, unter dem die Menschen sich sammeln.« Nunmehr engagiert sich Strelkov im humanitären Bereich. Er steht der von ihm ins Leben gerufenen »Bewegung Novorossia« vor. Hierbei handelt es sich um eine Koordinierungsorganisation für mehrere Gruppen, die sich mit der Hilfe für Flüchtlinge und der Versorgung der Milizen mit nichtletalen Materialien befassen. Binnen kürzester Zeit schlossen sich derzeit vierzehn Organisationen der Bewegung an und richteten drei große Versorgungs- und Auslieferungszentren ein. Doch die Masse der Versorgungsleistungen kann und muss laut Strelkov allein die Russische Föderation gewährleisten.
Um zum Ende zu kommen: Die Bewertung Person Igor Strelkovs offenbart die tiefe emotionale Kluft zwischen der slawischen Kultur, in der die Befindlichkeiten der Gemeinschaft über dem Wohl des Einzelnen stehen, und den westlichen Werten, die den Einzelnen in den Mittelpunkt rücken. Strelkov verkörpert das typische Klischee eines Russen - abwechselnd leidenschaftlich und nüchtern, mal aufbrausend und mal melancholisch, hart gegenüber dem Feind und aufopferungsvoll gegenüber dem Freund.
Einst wird die Geschichte über Igor Strelkov richten. Ich fühle mich dazu außerstande. Zu sehr bin ich selbst stets ein Soldat geblieben, um ihn nicht verstehen zu können. Doch verstehen heißt nicht rechtfertigen, um es klar zu unterstreichen. Auf jeden Fall wird der Name Strelkov noch sehr lange mit dem Ukrainekonflikt verbunden bleiben. Wie das Urteil der Geschichtsschreiber über den Obersten ausfallen wird, bestimmen letztlich allein die Sieger. Und Strelkov hat das Siegen gelernt.
PS: Demnächst werden wir Igor Strelkov erneut begegnen - in der Analyse des Kampfes um Slavjansk und Kramatorsk.
Taras Sirko - 29. Nov, 18:17
Die Feldkommandeure der Miliz halten in ihren Verbänden strenge Disziplin. Für eine Miliz ist dies eher ungewöhnlich. Aber es geht vor allem um einen eisernen Grundsatz, nach dem der Schutz der Zivilisten und deren wenigen Habseligkeiten das oberste Gebot des Handelns ist. Wer als Milizionär einen Zivilisten ausraubt oder bestiehlt, wird archaisch bestraft: zehn Hiebe mit der Nagaika und Ausschluss aus der Miliz, womit der Verlust der geringen Privilegien verbunden ist, wie beispielsweise kostenlose Heizmaterialien für die Familienangehörigen (ähnliches gibt es auch auf der Gegenseite). Diese Verfahrensweise zeigt neben den traditionell harschen Sitten im russischen Militär, die ich nicht weiter bewerten möchte, allerdings auch die Zuwendung der Bewaffneten zur Zivilbevölkerung. So gaben in der Stadt Stachanow, die vor dem Krieg etwa 83.000 Einwohner zählte, die Milizionäre der dortigen kleinen Garnison all ihre Lebensmittelrationen an die Zivilbevölkerung weiter. Es wurde einfach eine Feldküche auf dem Marktplatz aufgestellt und das zubereitete Essen an die Einwohner verteilt. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man die katastrophale humanitäre Lage im Donbass bedenkt.
Anders erging es den Menschen in der Siedlung Novosverdlovsk nahe Lugansk, die einige Zeit lang vom ukrainischen Bataillon Aydar besetzt war und nun von den Separatisten kontrolliert wird. Der Ort ist zerstört und menschenleer. Die Mitglieder des Aydar-Bataillons sind keine Faschisten. Es sind Lehrer, Anwälte, Ärzte - Angehörige des Bildungsbürgertums, die sich als Patrioten bezeichnen. Das Bataillon untersteht nicht der Armee oder der Nationalgarde, sondern dem Innenministerium. Es übernimmt Sicherungsaufgaben im Hinterland und trägt rote Kennungen. In Novosverdlovsk haben die Aydar-Freiwilligen die russisch-orthodoxe Kirche schwer beschädigt, den Friedhof verwüstet, die Häuser und Wohnungen geplündert und das Lenindenkmal zerstört. Wie eine Horde entlaufener Schwerkrimineller traten die Aydar-Leute auf die Überreste des Denkmals ein. Denn alles Russische wird seit einigen Monaten mit wilder Wut gehasst - die Kultur, die Sprache, die Menschen.
Vor einem Jahr lebten in den Oblasts Donezk und Lugansk etwa 6,5 Millionen Menschen, in der Masse Russen und russischsprachige Ukrainer. Lugansk ist mit einem Anteil von rund 90 Prozent ethnischer Russen die russischste Stadt in der gesamten Ukraine. Mehr als zwei Millionen Menschen sind aus dem Konfliktgebiet geflohen, die Mehrheit der verbliebenen Einwohner der beiden Oblasts leben in den Gebieten der nicht anerkannten Volkrepubliken Donezk und Lugansk. Die meisten fühlen sich unter dem Schutz der pro-russischen Milizen besser aufgehoben als unter der Kontrolle der ukrainischen Sicherheitskräfte, die von vielen als Besatzer empfunden werden.
Dies darf nicht verwundern. Durch ukrainischen Beschuss wurden 4.600 Wohnhäuser zerstört oder beschädigt, dazu vierzig Krankenhäuser, fast 300 Schulen und über 400 Einrichtungen der Versorgung mit Energie, Wasser und Wärme. Die humanitäre Situation ist katastrophal. Kaum jemand nimmt dies zur Kenntnis. Während im deutschen Fernsehen nahezu täglich über Kriegs- und Armutsflüchtlinge berichtet und eine Willkommenskultur eingefordert wird, hält man sich hinsichtlich der Zustände im Donbass eher bedeckt. Die klare Zuweisung der Verantwortung an Russland, die russophob-propagandistische Berichterstattung und der politische Rechtspurismus verdrängen jedwede Offenlegung der tragischen Lage der Donbassbewohner. Diese erwarten auch keinerlei Hilfe vom Westen oder aus Kiew, sondern einzig von Russland. Die Fronten sind klar, die Rollen verteilt.
Als vor Monaten der erste Hilfskonvoi der Russischen Föderation nach ergebnislosen Verhandlungen mit der Kiewer Regierung endlich eigenmächtig die Grenze überquerte, war am Grenzübergang eine Webcam [1] geschaltet. Man konnte per Fernübertragung in Bild und Ton miterleben, wie eine sichtlich ratlose Mitarbeiterin des Internationalen Roten Kreuzes mit einem Grenzoffizier diskutierte, man konnte Journalisten und Schaulustige sowie die wartenden rund 100 LKW sehen. Dann öffnete sich plötzlich der Schlagbaum, die Rot-Kreuz-Mitarbeiterin wirkte noch ratloser, die Zivilisten applaudierten und der Konvoi setzte sich in Bewegung. Sofort wurden die zum Konvoi gehörenden Tanklaster beanstandet, weil sie angeblich Treibstoff für die Separatisten beförderten. Hätte man die Bilder der Live-Kamera angesehen, hätte man auch die Notstromaggregate zur Kenntnis genommen, für deren Betrieb die Kraftstoffe bestimmt waren. Panzer konnten sich nicht auf den 20-Tonnern befinden, denn ein russischer Kampfpanzer wiegt etwa 45 Tonnen. Und unter den Planen versteckte Soldaten, von denen die Rede war, wären innerhalb der langen Wartezeit erstickt, verdurstet oder verhungert.
Mittlerweile gab es acht dieser staatlichen Hilfslieferungen aus Russland, ein jeder bestehend aus 100 Fahrzeugen mit 2.000 Tonnen Fracht: Lebensmittel, Medikamente, Winterkleidung, Baumaterialien, Schulbücher. Neben den Lieferungen des russischen Staates passieren täglich Dutzende Fahrzeuge aller Größen die Grenze und bringen zivilgesellschaftlich organisierte und privat gespendete Hilfsgüter in den Donbass. Die Krim hat einen eigenen Versorgungskonvoi gesendet. Die Solidarität der Russen ist gewaltig. Und jedes einzelne Kilogramm Hilfe wird dringend benötigt. Es ist überlebensnotwendig. Nahrungs- und Arzneivorräte sind aufgebraucht.
Hilfe seitens der Ukraine gibt es für die Menschen im Donbass nicht. Unmittelbar nach der Machtübernahme der pro-westlichen Kräfte in Kiew wurden den Regionen sämtliche Gelder abgenommen und zentral verwaltet. Die meisten Mittel wurden und werden für den Krieg im Donbass eingesetzt. Ab dem 1. Dezember 2014 wird die ukrainische Regierung die Zahlung von Renten, Pensionen, Gehältern und Sozialleistungen für die Bewohner in den Separatistengebieten komplett einstellen. Sie werden von allen Leistungen abgekoppelt. Seit einigen Tagen liefert das Gesundheitsministerium der Ukraine keine Medikamente mehr in den Donbass. Gleichzeitig zieht man dort immer mehr Truppen zusammen. Faktisch hat die Kiewer Regierung die Menschen im Donbass aufgegeben. Alle staatlichen Verpflichtungen dem Donbass gegenüber sind Geschichte, die Einwohner sind nicht mehr Teil der ukrainischen Bevölkerung. Man will die Menschen nicht mehr haben - aber deren Land will man zurückerobern.
Was soll noch werden? Wie stellen sich die pro-westlichen Machthaber und deren westlichen Verbündeten die künftige Staats- und Gesellschaftsordnung der Ukraine vor? Soll der pro-russische Bevölkerungsanteil bis in alle Ewigkeit mit Waffengewalt unterdrückt werden und in einem riesigen Freiluftgefängnis jahrzehntelang unter Kriegsrecht stehen? Damit man in den Bergbaugebieten lukratives Fracking betreiben kann?
Nein, es wird kein Miteinander mehr geben. Die faktische Teilung kann innerhalb der nächsten drei oder vier Generationen nicht überwunden werden. Die meisten Menschen im Donbass denken nicht daran sich zu beugen und sind bereit, allen Widerständen zu trotzen. Sie sind mehrheitlich Bergleute, Fabrikarbeiter, Bauern, Kosaken. Schicksalsergeben und leidensfähig. Sie sind russisch. Und sie haben einen festen Willen und ihre eigenen Vorstellungen von Freiheit und Gerechtigkeit - auch wenn es dem »Westen« nicht passt.
[1] Eine Randepisode: Auch in Donezk waren eine Zeitlang mehrere Webcams geschaltet. Man sah menschenleere Straßen, beschädigte Häuser und im Hintergrund dicke Rauchschwaden. Im zugehörigen Live-Chat unterhielten sich User über die übertragenen Bilder. Meist auf Englisch. »Wo bleibt die Action?« war zu lesen, oder »Schmeißt endlich mal ein paar Bomben.« Diese Sprüche kamen von »Verteidigern von Recht und Freiheit, von Demokratie und Menschenwürde«? Mitnichten. Blutrünstiges Gesindel gibt es auf allen Seiten. Doch nach allem Gesehenen und Recherchierten sind es weniger die Milizen und Zivilisten im Donbass, die sich »Blut, Action und Bomben« herbeisehnen. Es sind eher die unterbelichteten Trotz-allem-Verfechter abstrakter Begriffe, denen in ihrem politisch-ideologischen Wahn in Herz und Hirn längst ein wichtiger Baustein für eine gerechte Welt abhanden gekommen ist: Menschlichkeit!
Taras Sirko - 29. Nov, 14:13
Falls nichts dazwischen kommt, wie bspw. ein Erdbeben im Keller (mich wundert nichts mehr), gibt es über das Wochenende mal wieder zwei ausführlichere Beiträge.
Einer davon wird sich mit der durch den Konflikt im Donbass hervorgerufenen sozialen Lage der Menschen und der humanitären Situation befassen.
Außerdem ist ein ausführlicheres Porträt über eine im Westen verhasste und im Osten hoch geachtete Leitfigur der pro-russischen Kräfte geplant: Igor Strelkow (alias Igor Girkin).
Taras Sirko - 27. Nov, 14:33
Wer sie sind und wer sie rief:
SIEHT MAN HIER!Taras Sirko - 27. Nov, 13:10
Den Umständen entsprechend geht es dem (noch immer) meist fröhlich lachenden Journalisten gut, möchte man meinen. Er telefoniert fleißig und wird mit Orangen und Bonbons versorgt.
Hier der Link zu einem Krankenhaus-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=iDG7S0hM1J0
Und das geschah unmittelbar vor der Verwundung:
http://cassad.net/tv/videos/3000/
(Englisch untertitelt)
Taras Sirko - 25. Nov, 23:36
»Scheiß drauf, wir sollten Waffen nehmen und die verdammten Katsaps (Russen) töten, zusammen mit ihren Anführern.« - J. Tymoschenko
»Sehen Sie, ich selber bin bereit ein Maschinengewehr in die Hand zu nehmen und dem Drecksack (Putin) in den Kopf zu schießen.« - J. Tymoschenko
»Verdammt, wir sollten Atombomben auf sie abschießen.« - J. Tymoschenko auf die Frage was man mit den acht Millionen Russen in der Ukraine machen solle
»Angela war die stärkste Anführerin für Demokratie und Freiheit.« - J. Tymoschenko über Bundeskanzlerin Merkel
»Willkommen in der Freiheit.« - A. Merkel
Taras Sirko - 25. Nov, 13:30
Wenn man sich das Selbstverständnis des Freiwilligenbataillons »Krim« der auf der Kiewer Seite kämpfenden Krim-Tataren zu Gemüte führt, liest man kein Wort von westlichen Werten. Es geht um Ehre und Eigentum, um die Gräber der Vorfahren (die eigentlich mongolische Besatzer waren), um den Islam in der Ukraine. Die Rede ist sogar von einem Verteidigungs-Dschihad gegen den »russischen Faschismus«. Nun gut, aus der CDU-Parteispendenaffäre um Altkanzler Helmut Kohl habe ich von der SPD »gelernt«, dass Ehre ein Wort aus der Ganovensprache ist, aber gewiss kein westlicher Wert. Bedauerlicherweise, denke ich in jüngster Zeit immer häufiger. Und auf den Dschihad beruft sich jedwede islamistische Schlächterbande in Syrien, im Irak, in Nigeria und anderswo. Vielleicht auch irgendwann in Europa.
Aber man kann ersehen, wie mental unterschiedlich die Menschen in West und Ost sind. Denn auch auf pro-russischer Seite geht es um Ehre, während man in Europa kaum noch andere Themen als Multikulti und Multireli, Konsum, Fitnessarmbänder, Öko-Essen und Klimawandel, Gleichstellung und Homo-Ehe kennt. Sowie Abtreibung, Sterbehilfe und social freezing. Mir jedenfalls scheint es, als wären die verfeindeten Gruppen in diesem Konflikt sich gegenseitig dann doch näher als sie den Menschen des Westens sind.
Die innere Zerrissenheit der Ukraine gab es historisch zu allen Zeiten. Schon die Saporoger Kosaken unterteilten sich bisweilen in pro-polnische und pro-russische Gruppierungen, die sich oftmals untereinander bekämpften. Am Ende, dank der Zusicherung der alten Rechte durch das Zarentum, setzten sich die pro-russischen Kräfte durch. Im Gegensatz zu anderen Kosakenverbänden sind die Saporoger Kosaken allerdings nur noch Folklore.
Derzeit wird die Ukraine nicht durch ein Bekenntnis zu westlichen Werten zusammengehalten, sondern von einem Reinkultur-Nationalismus, der jede Gemeinsamkeit der Ukrainischsprachigen mit den Russischsprachigen mehr und mehr verleugnet - historisch wie kulturell. Selbst der Sieg über Hitler ist nicht mehr verbindend. Man schreckt nicht mal mehr davor zurück, die äußerst umstrittene Figur Stepan Bandera aus der Mottenkiste zu holen und sogar der Schreckensgestalt Joseph Goebbels einen gewissen Raum zu geben. Eine multiethnische Gesellschaft ist während des Konflikts erneut in einzelne Völker zerfallen. Das Gerede von einer »Geeinten Ukraine« ist zur hohlen Phrase geworden, zumal diese Einheit vorrangig mit Waffengewalt erzwungen werden soll.
Während der Ukraine der Zerfall droht, rücken die Russen enger zusammen. Das schwarz-orange Band verbindet sie mehr denn je mitreinander. Partei- und gesinnungsübergreifend. Der Niedergang der Geeinten Ukraine ist zugleich das Erwachen des Geeinten Russlands. Der lange Jahre träge und müde herumliegende Bär reckt seine Glieder und besinnt sich auf seine große Vergangenheit. Auf die Ehre und auf die Gräber der Vorfahren.
Hier schließt sich der Kreis.
Taras Sirko - 25. Nov, 12:23
Manchmal sehe ich mir Videos ohne Ton an, oder ich betrachte Fotografien ohne die Beschreibung zu lesen. Auf diese Weise wirkt nur der visuelle Eindruck auf mich ein, nicht aber die Bewertung durch Dritte. Und manchmal beschreibe ich dann das Gesehene, wobei ich um Neutralität bemüht bin, obwohl ich wie jeder andere Mensch natürlich irgendeine Meinung vertrete und irgendeiner Seite näher stehe. Daraus mache ich auch keinen Hehl.
Zu meinen bevorzugten Quellen gehören die Video- und Fotoberichte des britischen Journalisten Graham Phillips. Die meisten deutschen Medien würden diese Quelle als unseriös bezeichnen, denn Phillips arbeitet freiberuflich für den russischen Staatssender
Russia Today (RT). Zu Beginn der Krise berichtete Philipps auch aus anderen Gebieten der Ukraine. Dort wurde er zweimal wegen angeblicher Spionage und Unterstützung des Terrorismus festgenommen und anschließend nach Polen abgeschoben. Der pro-westliche Gouverneur von Dnepropetrovsk hat sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.
 Graham Phillips in einem zerbombten Stadtteil von Donezk
Graham Phillips in einem zerbombten Stadtteil von Donezk
Im Gegensatz zu den meisten anderen Reportern zeigt er Bilder unmittelbar von der vordersten Frontlinie, er spricht mit den Beteiligten vor Ort und setzt sich dabei höchster persönlicher Gefahr aus, anstatt bequem und sicher bei facebook und twitter zu »recherchieren«. Er schläft oft bei den Milizen in deren Unterständen an der Kampflinie, isst und trinkt mit den Kämpfern; er hat sich sogar im Rahmen eines Überlebenstrainings für eine halbe Stunde lebendig begraben lassen. Niemand zeigt diesen Krieg aus einer näheren Perspektive als er.
Heute ist Graham Phillips verwundet worden. Ein Splitter einer 122-Millimeter-Mörsergranate durchdrang in der umkämpften Siedlung Peski seine Schutzweste und verletzte ihn am Rücken. Milizsoldaten haben ihn umgehend in ein Donezker Krankenhaus gebracht. Eigentlich wollte er in einigen Tagen seine Verwandten in Großbritannien besuchen, um später wieder in den Donbass zurückzukehren. Das muss nun wohl warten.
Alles Gute, Graham, und beste Genesungswünsche!
Taras Sirko - 24. Nov, 17:25
orthodoxe Geistliche sind anwesend, um eine Truppenfahne zu weihen? Nicht weniger als acht. Das Beweisvideo:
HIER!Taras Sirko - 22. Nov, 12:09